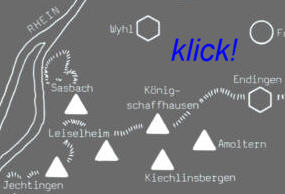|
Alemannisches
Dialekthandbuch vom Kaiserstuhl und seiner Umgebung
s Olga - diskriminierter als
d
Olga?
Zum Artikel bei Mädchen- und Frauennamen
Die
Karte zeigt
die Ortschaften, in denen die Mädchen- und Frauennamen
traditionell sächlichen Artikel haben, ‘die Olga‘
heißt dort also s Olgaa.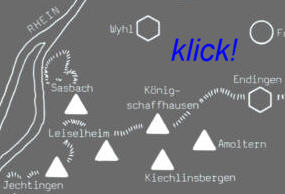
Das
Verbreitungsfeld des sächlichen Frauennamens konzentriert sich
im Breisgau nahe des Rheins; das Hauptverbreitungsfeld muß aber
im Elsaß liegen, dort sagen die Leute s Süsann (Susanne), s Ivedd (Yvette), s
Ghádrin (Catherine) usw. Eine ältere, aus der
Mode gekommende Form für ‘Katherina‘ ist s
Ghádel (siehe oben zitiertes Lied). Im
Badischen sagt man eher s Gháder, doch auch
hier gilt diese Namensform als altmodisch - wie alle Namen, die
es in der “Hochsprache“ nicht in gleicher Form gibt.
Für
die alemannische Großstadt Basel bezeugt Rudolf Suter die
"freilich
stark im Rückgang begriffene Gewohnheit, die Namen kleiner
Mädchen auch ohne Verkleinerungssilbe sächlich zu
verwenden: ‘s Dòòredee‘ (Dorothea), ‘s
Maaryy‘ (Marie), ‘s Maariann‘ (Marianne) usw.
Im Sprachgebrauch des intimeren Familien- und Freundeskreises
können dann auch Namen von erwachsenen oder gar bejahrten
Frauen dieses sächliche Geschlecht beibehalten, zum Ausdruck
besonderer Affektion: 'S Maaryy goot au schò gegen achzig.'
"1
Den
sächlichen Artikel s bei Mädchen- und Frauennamen
scheint es auch sonst hie und da im alemannischen Sprachraum zu
geben, man hat es mir aus der Müllheimer Gegend, vom Hochrhein (Grenzach) und aus der Schweiz2 berichtet, dort zum Teil
als ds.
Spuren
einer sächlichen grammatischen Auffassung des Frauennamens oder
der Frau finden sich in der Kaiserstuhlgegend auch in
Ortschaften, wo der Frauenname im allgemeinen noch (oder wieder?)
weiblich ist:
*
In Endingen, Malterdingen, Wasenweiler, Schelingen und
Wyhl sagt man häufig oder immer si (sein)
statt ihrá: d Mariaa isch in dr Arnaa si
Doochder. Dieses si kommt auch in
Buchheim, Bötzingen, Neuershausen, Merdingen, seltener in
Nimburg und veraltet in Umkirch vor; als mehr oder weniger
häufiger “Ausrutscher“ wohl auch noch in weiteren
Ortschaften. In Gottenheim ist belegt: in dr Godi sinem
Vader (dem Vater der Patin).
*
Obwohl in Endingen und in Wyhl der Mädchen- und
Frauenname weiblich ist, sagt man zum Beispiel áás
hed nid wellá mid, das heißt, “es“
wollte nicht mit, gemeint ist also etwa d Friidaa oder die Frau von dem und dem.
*
Hie und da gibt es offenbar auch in d-Ortschaften
Frauennamen mit s. In Malterdingen bezeugten
meine beiden Gewährsfrauen die Namen s Doorli, s
Draudel (beide Namen fangen mit D an). In Umkirch
erinnerte ein Gewährsmann sich an s Doorli, s Roosili (beide Namen sind in der Verkleinerungsform); ähnlich in
Neuershausen, dort nannten mir die Gewährsmänner s
Reesli, s Annili. Diese Namen trugen ältere Frauen
am Ort (und nicht etwa nur Mädchen).
*
In etlichen Ortschaften, wo der Frauenname normalerweise
weiblich ist, zum Beispiel in Endingen, Malterdingen,
Eichstetten, Bötzingen, Waltershofen und Merdingen, heißt
es s Ärnaas Gaardá (Ernas Garten). Das
sagt man in Buchheim und Neuershausen zwar nicht, doch ist
dort (wie auch in den anderen genannten Ortschaften) s
Muáders Bedd (Mutters Bett) oder s
Grooßilis Zimmer (Großmutters Zimmer) ein
alltäglicher Ausdruck (gewesen). Dieses s stimmt
mit dem männlichen und sächlichen Artikel im wessen-Fall
überein (s Vaders Schdrimbf;
seltener: s Máidlis Schuá); eine
solche Konstruktion ist auch im Hochdeutschen möglich
(‘des Vaters Strümpfe‘, ‘des Mädchens
Schuhe‘).
Der
sächliche Artikel bei Frauennamen ist auch in seinem
geschlossenen Verbreitungsgebiet im Westen durch das Hochdeutsche
bedrängt; etwa in Breisach ist er beinahe schon verdrängt -
dort sagen meist nur noch ältere Leute (und meist nur noch zu
älteren Frauen) s Ärnaa, s Leen, s Sofii usw.
Auch in einigen anderen Ortschaften ist die Neigung, zum
weiblichen Artikel überzugehen, bemerkbar. Und zwar besonders
bei den Namen jüngerer Mädchen, zumal wenn die Namen nicht
alemannisiert sind oder gar nicht traditionell sind. Das müßte
nicht so sein: die Eltern könnten ebensogut s Nadiin sagen
wie d Nadiin, ebensogut s Fanessaa
wie d Vanessaa, ebensogut s Ghärschdiin wie d Ghärschdiin.
Als
Ursache der Verdrängung kommt, wie bei so vielen anderen
Eigenheiten des Alemannischen, die Macht des hochdeutschen
Spracheinflusses in Frage, die Macht ständiger hochdeutscher
Berieselung. Aber auch das Empfinden der Betroffenen selber
spielt eine Rolle: Wenn Frauen in eine der s-Ortschaften
zuziehen, dann stellt sich die Frage, wie sollen die
Ortsansässigen sie nennen. Wird der einheimische Held sich
getrauen, seine zugezogene Braut s Brigidd statt d
Brigidde zu heißen? Und wird sie es akzeptieren?
Steine des Anstoßes
Es
gibt Frauen und Männer, die den sächlichen Artikel bei
Mädchen- und Frauennamen für unzeitgemäß, für ein Zeichen
einer Minderberechtigung der Frau halten. Ein ähnliches Problem
gibt es im Hochdeutschen. Gerade in fortschrittlichen Kreisen
sehen viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller es kritisch,
daß das Männliche im Hochdeutschen eine Art grammatisches
Leitgeschlecht ist
Wenn
nicht ausdrücklich von Frauen die Rede sein soll, wird im
Hochdeutschen normalerweise die männliche Wortform genommen:
‘Lehrergewerkschaft‘, ‘Studentenwerk‘,
‘Arbeiterwohlfahrt‘, und dies, obwohl auch Lehrerinnen,
Studentinnen oder Arbeiterinnen Mitglieder, Mitarbeiterinnen oder
Ansprechpartnerinnen dieser Organisationen sind. Mehr noch: Wenn
Frauen von Frauen oder von einer gemischten Gesellschaft
sprechen, sagen gewöhnlich auch sie an entsprechender Stelle
‘man‘, ‘jedermann‘, ‘jemand‘,
‘niemand‘ und “macht mal einer das Fenster
auf?“.
In
fortschrittlichen Kreisen dagegen ist man/frau zum Teil
dazu übergegangen, beide Geschlechter aufzuführen, wie ich es
hier und im nächsten Satz nachmache.
Bei
manchen hochdeutschen SchriftstellerInnen ist das
Männliche von vorneherein negativ belegt: Eine Frau fragte mich
zum Beispiel in einer (damals noch geteilten) norddeutschen
Großstadt einmal: “Warum heißt es denn ‘die Bombe‘?
Das müßte doch ‘der Bombe‘ heißen!“ (das
Thema war ‘die Atombombe‘). So liegt das Problem im
Hochdeutschen.
Die grammatischen Geschlechter im
Kaiserstühlerischen
Im
Alemannischen liegen die Dinge etwas anders. Zwar sagen die
Kaiserstühler auch Lährer, Schdüdándá, Arbáider, selbst wenn Lährerná, Schdüdándinná,
Arbáiderná dabei sind. Aber das Leitgeschlecht ist im
Alemannischen bei unbestimmten Wörtern und Fürwörtern oft
sächlich:
*
Wir sagen á mánks (mancher, manche), á
Granks (ein Kranker, eine Kranke), á
Jungs (eine junge Person), á Frámds
(ein Fremder, eine Fremde), gháins vu báidá (keine, keiner von beiden) usw. usf.
*
Gute Dialektsprecher sagen zwar zwee Mánner
oder zwoo Fraüá, wenn aber ein
Mann und eine Frau gemeint sind, sagen sie keineswegs das
männliche zwee, sondern das sächliche zwái.
*
Das hochdeutsche 'man' geht sprachgeschichtlich
tatsächlich auf das althochdeutsche Wort für
‘Mann‘ zurück, so auch die Wörter
‘jemand‘, ‘jedermann‘,
‘niemand‘. Der Ursprung des alemannischen mr
(man) und niámá (niemand) ist gleichwohl das
althochdeutsche (altalemannische) Wort für ‘Mann‘
oder eine Wortverbindung mit ‘Mann‘. Aber wie die
weitere Entwicklung dieser Wörter beweist, legten die
Alemannen keinen Wert auf die gedankliche Verbindung mit
‘Mann‘; sie ist in den heutigen Wörtern fast nicht
mehr sichtbar. Unser mr (man) ist im
Gleichklang mit mr (wir); niámá kommt auch in der Form niámes oder niámed
vor. Unser Wort für ‘jemand‘, eber, hat gar keine Wurzel in ‘Mann‘, es geht auf das
mittelhochdeutsche (mittelzeitalemannische) 'etwer' zurück,
hat also Ähnlichkeit mit ‘irgendwer‘.
Neben
dem männlichen gibt es im Alemannischen also auch ein
sächliches, besser gesagt ein neutrales oder unbestimmtes
grammatisches Leitgeschlecht. Das sächliche Geschlecht ist im
Kaiserstühler Alemannischen keineswegs nebensächlich und so
sind auch die Frauennamen keineswegs mit einem nebensächlichen
Geschlecht bedacht.
Das
Alemannische bräuchte den Vorwurf der Vorherrschaft des
Männlichen in der Sprache weniger zu fürchten als das
Hochdeutsche. Doch sind gegenüber einer ideologischen Wertung
der grammatischen Geschlechter sowieso grundsätzliche Zweifel
angebracht:
*
Zahlreiche Wörter haben im Lauf der Jahrhunderte ihr
Geschlecht geändert: Im Mittelalter hieß es zum Beispiel
‘der bluome‘, heute d Bluám (die
Blume). Dr Schnágg scheint im ganzen Breisgau
männlich zu sein, aber wenige rheinnahe Orte haben d
Schnágg (vgl. Karte 31, S. 358). Beim Iil (bei der Eule) sind die Verhältnisse gemischt; man
trifft ihn auch als d Iilá an (vgl.
§56, S. 476). Auch beim Áágerschd (Elster)
ist die alemannische Sprachgemeinschaft gespalten (vgl. Karte
1, S. 8), ungefähr die Hälfte der Ortschaften sagt d
Áágerschdá. Es ist m.E. auch keine
Gesetzmäßigkeit unter dieser Vielfalt erkennbar.
*
Natürlich stimmen auch in den einzelnen indogermanischen
Sprachen die grammatischen Geschlechter nicht überein, sehr
zum Leidwesen zahlloser Oberschüler zwischen Ural und
Atlantik, ja noch darüber hinaus. So ist ‘der
Mond‘ zum Beispiel im Französischen weiblich, ‘die
Katze‘ dagegen männlich. Und warum liebt der moderne
Mensch das Englische so? Sicher auch, weil im Englischen die
meisten Wörter sächlich sind; Schülerinnen und Schüler
brauchen auf das Auswendiglernen der Artikel keine Mühe zu
verwenden; das männliche und weibliche grammatische
Geschlecht spielt im Englischen nur noch im Zusammenhang mit
menschlichen Personen eine Rolle.
*
Wenn aus dem grammatischen Geschlecht des Frauennamens
auf eine Diskriminierung oder Nicht-Diskriminierung der Frau
geschlossen werden könnte, müßte sie sich ja in
verschiedenen Gesellschaften nachweisen lassen:
-
Zum Beispiel in islamischen Gesellschaften herrscht, aus
westlichem Blickwinkel gesehen, eine starke
Unterdrückung der Frau. Sie müßte sich dann auch in
der Sprache nachweisen lassen. Um es vorwegzunehmen: die
meisten Sprachen sind in den Grundzügen viel älter als
der Islam. Das Türkische etwa kennt gar kein
grammatisches Geschlecht, zum Beispiel
‘arkadas‘ heißt ‘Freund‘ und
zugleich auch ‘Freundin‘. Wenn Sie unbedingt
wissen wollen, ob ‘arkadas‘ eine Frau oder ein
Mann ist, müssen Sie umständlich nachfragen. Auch sonst
wird nicht leichtfertig verraten, ob ein Mann oder eine
Frau im Spiel ist: Zum Beispiel ‘sie ist da‘
heißt das gleiche wie ‘er ist da‘ oder
‘es ist da‘: ‘buradadir‘.
-
Wenn der sächliche Artikel beim Frauennamen zum Nachteil
der Frau wäre, müßte sich dies in den betreffenden
Ortschaften ja nachweisen lassen. So müßte es d
Maarii in Eichstetten (d-Ort) besser haben als s
Maarii im benachbarten Bahlingen (s-Ort).
In
Ihringen nennt man Frauen im mittleren Alter und älter meist
noch s ... . Mädchen und jüngere Frauen werden
oft schon als d ... bezeichnet. Die Tochter wird
von ihrem Mann, ihren Bekannten und von ihrem Chef schon d
Sasgjaa genannt; die Mutter nennen alle noch s
Efeliin. Ob es der Saskia wohl besser geht als im Eef? Wir können Wohlergehen nicht objektiv messen, wir müssen
nach äußeren Erscheinungen gehen:
Nach
ihrer Scheidung zieht d Sasgjaa mit drei Kindern am
Hals wieder zu ihren Eltern, zum Efeliin und
zum Sebb. Ihr Ex-Mann zieht nach Freiburg zu
dr Schagliin (Jaqueline). So weit, so schlecht.
Die endgültige Antwort auf die Frage, wer das bessere Lebenslos
gezogen hat, s Efeliin oder d Sasgjaa,
müssen wir schuldig bleiben.
Die
Annahme, daß der sächliche Artikel bei Frauennamen ein
diskriminierender Zug im Alemannischen sei, ist wohl nicht
haltbar.
Auch
im elsässischen und im rheinnahen Kaiserstühler Alemannisch war
der Artikel bei Frauennamen im Mittelalter noch weiblich. Der
sprachliche Brauch, das Mädchen (s Máidli)
‘es‘ (áás, s) zu nennen, wird
sich später auch auf den Vornamen ausgeweitet und ins
Erwachsenenalter hinübergerettet haben, sodaß jetzt auch eine
Erwachsene s Eefli, s Olgaa usw. heißt.
Der
sächliche Frauenname wird in den betreffenden Ortschaften
verwendet, wenn seitens des Dialektsprechers oder der
Dialektsprecherin Vertrautheit oder die Bereitschaft zu
Vertrautheit besteht. Wer es als einheimische oder zugezogene
Frau nicht schätzt, s ... geheißen zu werden,
kann es sich natürlich verbieten, wie man sich auch verbieten
kann, geduzt zu werden ...
1 Rudolf Suter, Unser Baseldeutsch, Basel 1989
2 Beispiele aus der Schweizer
Dialektliteratur:
aus: (Hg.: Christian Schmid-Cadalbert u. Barbara
Traber), gredt u gschribe, Eine Anthologie neuer
Mundartliteratur der deutschen Schweiz, Aarau 1987:
- “Anneli hets
ghäisse, Anneli. ... Wenns guet gangen isch, het s
Anneli e Stund in der Wuche frei gha.“ (Helene
Bossert, Basel-Land)
- “Mängisch han i mi gfrogt, wieso dr Liebgott
mi vorgseh het für dr Otti i sir letschte Zit z begleite.
Wieso het Är s Sofi vor ihm lo schtärbe?“
(Wie in den betreffenden Kaiserstühler Ortschaften
hat im folgenden und unten im letzten Beispiel auch der
Rufname eines weiblichen Haustiers sächlichen Artikel:
- “Und s Miggi schloft und
schloft. Wenn äs einisch nümme do isch, wott
i kei nüii Chatz meh.“) (Ernst Burren, Solothurn)
- "Ja, es het g‘angschtet, ds
Luggi vo Wysseflueh, und de albe wieder mit sech gschumpfe, wil es wien es dumms Babi
tüegi.
Schliesslech syg es doch vor zäche Jahr
muetterseelenallei ga Amerika gfloge, für dert sy
Tochter Trixli und däm sy
Familie z‘bsueche ..." (“Ja, es hatte Angst,
das Luggi von Wyssefluh, und hat drum mit sich geschumpfen,
weil es sich wie ein Baby benimmt (“tüegi“ =
‘tue‘, vgl. ADH Seite 118). Schließlich ist es
doch (so sagt es zu sich selbst) vor zehn Jahren
mutterseelenallein nach Amerika geflogen, um dort seine
Tochter Trixli und dem seine Familie zu besuchen ...“) (Susy
Langhans-Maync, Bern)
aus: Adolf Winiger, Verzell de Chind Cschichtli, Muttenz
1980:
-
“Au s Monika, es Drittklassmeitli, hed gwösst, dass mer zum Wasser uus muess wenns blitzt.“
("Wenn s Liseli geschter scho kalberet
hätt ..." (“Wenn das Liseli gestern schon gekalbt
hätte ...“)) (Adolf Winiger, Luzern)
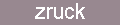
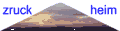
|