|
Alemannisches
Dialekthandbuch vom Kaiserstuhl und seiner Umgebung
Die historische Abwertung
des Alemannischen
 Die alemannischen Literaturdialekte sind auch in ihren Rückzugsgebieten
spätestens im Dreißigjährigen Krieg außer Gebrauch gekommen. An ihre Stelle
ist ein Neuhochdeutsch nach Lutherschem Vorbild oder nach dem Vorbild der “süddeutschen
Reichssprache“, dem Nachläufer der Kanzleisprache Kaiser Maximilians,
getreten. Im gleichen Jahrhundert kam es, so Adolf Socin, zu einer “Blüthe
der deutschen Litteratur im Norden und Osten, zumal in Schlesien, während die
breiten Striche des deutschen Landes unter den Verheerungen des dreißigjährigen
Krieges darnieder lagen.“ Die grammatische Regelung der deutschen Sprache ging
daher im 17. und 18. Jahrhundert “fast ausschließlich vom protestantischen
Norden“ aus. Die süddeutsche Reichssprache glich sich in vielem der
Schriftsprache des Nordens und Ostens an. Die alemannischen Literaturdialekte sind auch in ihren Rückzugsgebieten
spätestens im Dreißigjährigen Krieg außer Gebrauch gekommen. An ihre Stelle
ist ein Neuhochdeutsch nach Lutherschem Vorbild oder nach dem Vorbild der “süddeutschen
Reichssprache“, dem Nachläufer der Kanzleisprache Kaiser Maximilians,
getreten. Im gleichen Jahrhundert kam es, so Adolf Socin, zu einer “Blüthe
der deutschen Litteratur im Norden und Osten, zumal in Schlesien, während die
breiten Striche des deutschen Landes unter den Verheerungen des dreißigjährigen
Krieges darnieder lagen.“ Die grammatische Regelung der deutschen Sprache ging
daher im 17. und 18. Jahrhundert “fast ausschließlich vom protestantischen
Norden“ aus. Die süddeutsche Reichssprache glich sich in vielem der
Schriftsprache des Nordens und Ostens an.
Dennoch haben sich in manchen Gegenden und Orten
Oberdeutschlands alemannische oder oberdeutsche Spuren in der Schrift noch lange
gehalten, namentlich in katholischen.
Die abgebildete Inschrift auf dem Ghábiligriz (Kapellchenkreuz)
an der Straße von Oberrotweil nach Burkheim aus dem Jahre 1777
weist mehrere alemannische
Spuren auf. Der Steinhauer vom Ghábiligriz hätte auch “moderner“
schreiben können, er wollte aber offensichtlich nicht. Ähnlich altertümlich
wirkende Inschriften finden sich auch auf Kreuzen in anderen Ortschaften. In den
protestantischen Gemeinden finden wir bei Inschriften dieses Alters die Sprache
der Bibel nach Luther.
Eine
Landschaft “mit rauer Sprache“
Wie es im überwiegend katholischen Oberdeutschland mit
der gesprochenen Sprache stand, kommt in einer Streitschrift des Georg Litzel (Megalissus)
gegen den “undeutschen Catholick“ zum Ausdruck, die 1731 im sächsischen
Jena veröffentlicht wurde:
“Die Catholicken sind darinnen unglücklich, daß
sie meistentheils in solchen Landschaften gezeugt werden, worinnen eine raue
Sprache in Gebrauch ist. Doch wohnen in jeder Landschaft Leute, davon einige
nach der rauhen Mundart besser reden, einige schlechter. Da pflegen nun die
Eltern gemeiniglich nicht darauf zu sehen, welchen von beiden sie ihre Kinder
untergeben. Es gilt ihnen gleich, Mägde anzunehmen, sie mögen eine Sprache
haben, wie sie wollen. Sie lassen es geschehen, daß ihre Kinder unter dem
Gesinde herumlaufen und mit anderen Kindern spielen, von welchen sie sich keine
gute Mundart angewöhnen. Ja, oft reden vornehme und gelehrte Eltern selbsten
wie die grobe Bauern.“ (zit. nach A. Socin)
Das “Unglück“, in einer Landschaft mit „rauer
Sprache“ geboren zu sein, wiederfuhr im oberrheinischen und Schweizer Teil
Oberdeutschlands auch vielen Protestanten. Es wird bei ihnen auf den unteren
Ebenen kaum anders zugegangen sein als bei der römischen Konfession. Zumindest
in der Kaiserstuhlgegend hat sich bis heute in den evangelischen Ortschaften
eine ähnlich "rauhe Sprache" wie in den katholischen gehalten.
Um die Sprache der höheren Bildungsschicht oder gar der
Regierenden wird es nicht so “schlimm“ gestanden haben, wie Megalissus den
Eindruck erweckt. Sie werden ein Neuhochdeutsch mit mehr oder weniger starker
oberdeutscher Prägung gesprochen haben. Häufiger als heutige Herren werden sie
daneben noch die Volkssprache beherrscht oder wenigstens ihren Ton nachzumachen
gewußt haben.
Die Geringschätzung der oberdeutschen Dialekte, die aus
den Worten des Megalissus spricht, wurde von vielen Schriftstellern, gerade in
der literarischen Hochburg Sachsen, geteilt. Doch selbst in Festungen des
Alemannentums erfuhr die Volkssprache eine Abwertung. Dafür ein Beispiel:
Bereits 1680 ist den Predigern im protestantischen Bern befohlen worden, “sich des affektierten neuen Deutsch zu müßigen“.
1748 wurden die Geistlichen in einer neuen "Prädicantenordnung" ermahnt, “sich in dem Vortrag ihrer Predigt nicht einer
'allzu schlechten, verächtlichen Mundart und dem Worte Gottes unangemessenen Redart und
Gleichnissen' zu bedienen“. Ein Teil der Predigten wurden daher in Bern nicht
von der Kanzel herunter, sondern beim Taufstein gehalten, schreibt A. Socin,
"damit der Sprecher sich desto eher der Volkssprache bedienen dürfe".
Alemannisch am Taufstein unten wurde also eher geduldet als Alemannisch auf der
erhabenen Kanzel oben.
Goethe,
Hebel und Hansjakob über die Unterdrückung des Dialekts
Die Unterdrückung der Dialekte erfuhren auch der Franke
Goethe und der Schwabe Schiller am eigenen Leib. Was etwa dem jungen Goethe im sächsischen
Leipzig (1765 - 1768) widerfuhr, mag allen Kaiserstühler Oberschülern und
ihren Eltern zum Trost gereichen, die meinen, die Karriere müsse durch
Verschulden des Dialekts schon zu Ende sein, noch bevor sie begonnen hat.
Goethe war nämlich, wie er in ‘Dichtung und
Wahrheit‘ schreibt, “in dem oberdeutschen Dialekt geboren und erzogen“, er
sprach Frankfurterisch. Sein Vater hielt ihn zwar zu einem “besseren
Sprechen“ an, dennoch waren ihm bei seiner Ankunft in Leipzig "gar manche
tiefer liegende Eigenheiten“ geblieben. In diesen Eigenheiten gefiel er sich
(!), hob sie “mit Behagen hervor“(!), zog sich dadurch aber von seinen
“neuen Mitbürgern jedesmal einen strengen Verweis“ zu. So schreibt er ungefähr
1812/13, schon mit einem Vierteljahrhundert Abstand zu seiner Leipziger Zeit,
und fährt fort:
“Jede Provinz liebt ihren Dialekt: denn er
ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft.
Mit welchem Eigensinn aber die meißnische Mundart die übrigen zu
beherrschen, ja eine Zeitlang auszuschließen gewußt hat, ist jedermann
bekannt. Wir haben viele Jahre unter diesem pedantischen Regime gelitten,
und nur durch vielfachen Widerstreit haben sich die sämtlichen Provinzen in
ihre alten Rechte wieder eingesetzt. Was ein junger, lebhafter Mensch unter
diesem beständigen Hofmeistern ausgestanden habe, wird derjenige leicht
ermessen, der bedenkt, daß nun mit der Aussprache, in deren Veränderung
man sich wohl ergäbe, zugleich Denkweise, Einbildungskraft, Gefühl, vaterländischer
Charakter sollten aufgeopfert werden.“
Mit der “meißnischen Mundart“ meint Goethe die
Sprache der Gebildeten Obersachsens - sie war die tonangebende Form des
Neuhochdeutschen. Der Psychoterror dieser Gebildeten schüchterte Goethe soweit
ein, dass er, wenn man seinen eigenen Worten glauben darf, in Leipzig den Mund
fast nicht mehr aufbrachte. Er schreibt:
“Ich fühlte mich in meinem Innersten
paralysiert und wusste kaum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge zu
äußern hatte.“
In seinem Innersten gelähmt zu sein! Welcher Kaiserstühler
Dialektsprecher kennt nicht dieses Gefühl, wenn er in “hochsprachlichen“
Kreisen verkehrt, die ihn nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen?
Wir kommen im zweiten Teil des Buches darauf zurück. Bei Goethe ging es
freilich kaum um das sprachliche Verständnis; er war in seinen Leipziger Jahren
bereits Meister der Hochsprache. Es ging lediglich um Aussprache und Stil.
Johann Peter Hebel (1760 - 1826) fand das
Alemannische als "verachtete und lächerlichgemachte Sprache" vor. Durch seine
Dichtung fand die alte Sprache neue Berühmtheit (Celebrität). Wilhelm Altwegg
zitiert den im Wiesental gebürtigen Dichter im Vorwort zu seiner
Hebel-Werksausgabe:
“Ich kann in gewissen Momenten in mir unbändig
stolz werden und mich bis zur Trunkenheit glücklich fühlen, daß es mir
gelungen ist, unsere sonst so verachtete und lächerlich gemachte Sprache
klassisch zu machen und ihr eine solche Celebrität zu erringen.“ (Johann
Peter Hebels Werke, Teil 1, Atlantis-Verlag Berlin-Zürich, o.J.)
Die ‘Alemannischen Gedichte‘ von Johann Peter Hebel
erschienen 1803 in erster Auflage. An ihrem literarischen Ruhm dürfte der oben
schon zitierte Johann Wolfgang von Goethe nicht ganz unschuldig sein, der sich
als Jüngling in Straßburg verliebte und dabei - wes Wunder - auch das
Alemannische liebgewann. Er schrieb 1805 eine sehr wohlwollende Kritik der
Alemannischen Gedichte, vermag darin mitnichten, seine überschwängliche Freude
an dieser Sprache zu verhehlen. Die Alemannischen Gedichte wurden damit zur
Pflichtlektüre auch derjenigen Literaturfreunde überall im deutschen Land, die
sonst dem Alemannischen durchaus abhold sind.
1812 schreibt Goethe im thüringischen Weimar, seiner
Wahlheimat, anlässlich einer Neuauflage der wohl berühmtesten deutschen
Mundartgedichtesammlung:
„Hebels abermalige ‘Alemannische
Gedichte‘ geben mir den angenehmen Eindruck, den wir bei Annäherung von
Stammverwandten immer empfinden.“
Im ostmitteldeutschen Sprachraum, in der Umgebung
gebildeter Gesellschaftskreise, fühlte sich der Rheinfranke also dem Alemannen
stammverwandt. Hier empfindet sich Goethe offenbar als Oberdeutscher. Vielleicht
wollte er mit seinem “ich war nämlich im oberdeutschen Dialekt geboren“
und mit seinem Bekenntnis zur Stammverwandtschaft mit Hebel einen sprachlichen
und kulturellen Gegensatz andeuten, wie man ihn heute mit den Begriffen
“Norddeutsch“ und “Süddeutsch“ zum Ausdruck bringt, wobei er sich von
den Wurzeln her Letzterem zugehörig fühlte.
Goethe ist auch von den Worten zur Tat geschritten:
Obgleich er nur auf kurzen Reisen in der Schweiz weilte, konnte er es nicht
lassen, sich im Schweizerdeutschen zu versuchen. Er schrieb, so gut wie er es
konnte, ein kleines Gedicht auf Alemannisch. (Wir haben uns schon S. 93 damit
beschäftigt.) Dieses ‘Schweizerlied‘ beginnt:
“Uf‘m Bergli / bin i
gesässe,
/ ha de Vögle / zugeschaut; / hänt gesunge, / hänt gesprunge, / hänt
‘s Nestli / gebaut.“
Wie können es bloß andere Geistesgrößen in unserem
Land jahrzehntelang aushalten, ohne auch nur "Guten Tag" auf Alemannisch
herausbringen zu wollen?
 Daß die literarische Aufwertung des Alemannischen keine
nachhaltige Aufwertung im täglichen Leben bedeutete, läßt eine
Tagebucheintragung von Heinrich Hansjakob erahnen. Nach dem, was dieser
katholische Geistliche schreibt, erscheint auch die Einschätzung Goethes als
voreilig, “die sämtlichen Provinzen“ hätten sich im Bezug auf den Dialekt
“in ihre alten Rechte wieder eingesetzt“. Der gebürtige Kinzigtäler
notiert nämlich 1897 in der Freiburger Karthause: Daß die literarische Aufwertung des Alemannischen keine
nachhaltige Aufwertung im täglichen Leben bedeutete, läßt eine
Tagebucheintragung von Heinrich Hansjakob erahnen. Nach dem, was dieser
katholische Geistliche schreibt, erscheint auch die Einschätzung Goethes als
voreilig, “die sämtlichen Provinzen“ hätten sich im Bezug auf den Dialekt
“in ihre alten Rechte wieder eingesetzt“. Der gebürtige Kinzigtäler
notiert nämlich 1897 in der Freiburger Karthause:
“Bei uns Süddeutschen kümmert sich kaum ein Mensch
mehr um den Dialekt. Da regt sich keine Katze für die Erhaltung und Wertschätzung
der Volkssprache. Im Gegenteil, in unseren Schulen, Amtshäusern, Gerichtshallen
wird derselben der Krieg erklärt und dieselbe verhöhnt und verspottet. Spricht
einer bei uns vor Gericht preußisch, so hört der Amtsrichter andächtig zu;
redet aber ein Bauer in seinem Dialekt und der reserveleutnantliche Richter oder
Beamte, der bisweilen sogar noch ein echter Preuße* ist, versteht die Rede
nicht, so wird der Mann angeschnautzt und ihm zugeschrien, er solle
“deutsch“ sprechen (...).“
In der Fußnote führt Hansjakob aus:
*) „Im badischen Ländle spielen Leute aus aller
Herren Länder eine Rolle, ein Preuß aber gilt vielfach mehr als ein
Badischer.“
Die Abwertung einer Sprache ist immer verbunden mit der
Abwertung ihrer Sprecher. Die Abwertung des Alemannischen hat auch
staatspolitische Ursachen; von ihnen ist im nächsten Kapitel die Rede.
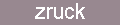
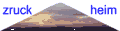
|